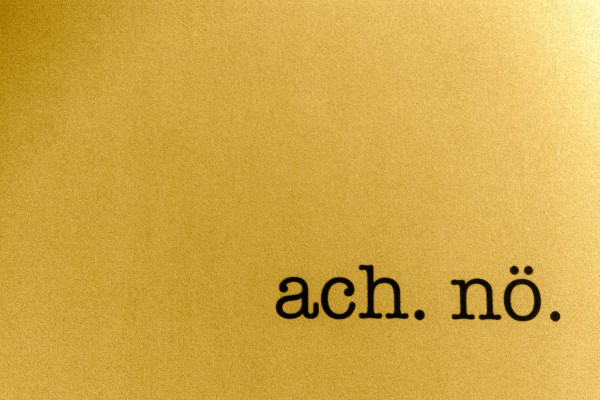Der Vorhang hebt und senkt sich. Das Licht erlischt, nur um jäh und grell wieder aufzublenden. Es ist eine Szenerie wie ein Flackern von halbgeöffneten Augenlidern im Zwischenreich von Schlafen und Wachen. Ganz so, als versuche man einen Albtraum abzuschütteln. In dieser Zwischenwelt tappst orientierungslos „die Alte“ (Elisabeth Orth) über die Gräber in der Wohnstube, als wären sie gar nicht da. Ihre Tochter, „die Mittlere“ (Christiane von Poelnitz) drischt unterdessen auf den Tisch ein, jenes verhasste Familien-Möbelstück, an dem zu vieles ungesagt blieb. Was für ein fulminanter, vielversprechender Einstieg ist Regisseur Robert Borgmann da in seiner Inszenierung von Ewald Palmetshofers „die unverheiratete“ gelungen.
Es ist ein Stück über verdrängte Schuld, die sich wie ein Geschwür durch die Generationen frisst. Kurz vor Kriegsende, im April 1945, hört „die Alte“ – damals freilich noch jung – ein Telefongespräch mit. Ein versprengter Soldat spricht vom „Abhauen“. Sie meldet es dem Ortsgruppenleiter und der Mann wird standrechtlich erschossen. Nach dem Krieg muss die Denunziantin für eine ganze Weile hinter Gitter. Die Frage nach der eigenen Schuld verdrängt sie jedoch erfolgreich. Und dennoch bleibt diese Schuld für Tochter und Enkelin nicht ohne Folgen. Die eine ist erfüllt von Hass auf ihre chronisch unterkühlte Mutter, die andere stürzt sich von einer Männergeschichte in die nächste.

Elisabeth Orth und Christiane von Poelnitz in Ewald Palmetshofers „die unverheiratete“. Eingeladen zum Theatertreffen 2015. Foto: Georg Soulek
Die Tat der „Alten“ ist Dreh- und Angelpunkt des Stücks und wird doch erst weit nach der Hälfte des Abends überhaupt konkret gemacht, als „die Junge“ (Stefanie Reinsperger) ein Heft findet mit Aufzeichnungen der Großmutter. Ob diese Reue empfand, sich ihrer Schuld bewusst war, das erfährt man auch jetzt nicht.
Versprechen wird nicht eingelöst
Ewald Palmetshofer hat ein hoch komplexes Drama geschrieben. Seine Sprache mutet seltsam aus der Zeit gefallen an, wird häufig mit der von Kleist verglichen. Er schreibt im wahrsten Sinne ohne Punkt und Komma. Seine Sätze führen häufig ins Leere oder in die Irre. Vergangenheit und Gegenwart, Erinnerung und Verklärung – alles überlagert sich in diesem Stück. Die Geschichte der „Alten“ wird in Rückblenden erzählt: Es gibt zwei Prozesse. Jenen, in dem der junge Soldat angeklagt ist und jenen, in dem die Denunziantin sich selbst verantworten muss. Es gibt zwei Anstalten. Das Gefängnis und die Klinik, in die „die Alte“ nach einem Zusammenbruch eingeliefert wird. Der Chor, bestehend aus den vier „Hundsmäuligen“, gibt hierbei keinerlei Orientierung, sondern dient mehr als Reminiszenz-Stimme einer alten Frau, die nicht nur dement ist, sondern zeitlebens die eigene Schuld zu verschweigen versucht hat.
Das alles ist wahnsinnig spannend. Das Problem ist bloß: Wer diese Dinge vorher nicht weiß, wer das Stück nicht eingängig studiert hat, dem fehlen die entscheidenden Schlüssel, um die Inszenierung zu verstehen. Und damit, um sie genießen oder ihr wenigstens etwas abgewinnen zu können. An manch einem rauscht der Theaterabend nahezu wirkungslos vorbei, verfehlt der an vielen Stellen starke Text seine Wirkung und das trotz der sagenhaften Leistung des ausschließlich weiblichen Ensembles. Das Versprechen des fulminanten Intros wird schlicht nicht eingelöst.
Modernes Theater benötigt Erklärung und Vorbereitung
Im anschließenden Publikumsgespräch fällt es dann, das Wort, um das es in diesem Beitrag gehen soll: „kommentarbedürftig.“ In seinem Buch „Das Theater der Gegenwart“ schreibt der Theaterwissenschaftler Andreas Englhart: „Dem zeitgenössischen Theater geht es wie der aktuellen bildenden Kunst. Es benötigt Erklärungen, Kommentare und Vorbereitungen, nur so kann es verstanden und diskutiert werden und Vergnügen bereiten.“ Diesem Zitat kann man nun ebenso zustimmen, wie man ihm widersprechen kann. Fakt ist jedoch: Auf viele Stücke, die beim diesjährigen Berliner Theatertreffen zu sehen waren – die genannte „unverheiratete“ natürlich aber auch „Warten auf Godot“ etwa – trifft das Geschilderte zu. Wer mit Begriffen wie „Postmoderne“, „Orestie“ und „Existenzialismus“ etwas anfangen kann, wer die Namen „Artaud“, „Brecht“, „Stein“ oder „Kortner“ nicht nur kennt, sondern den Einfluss der genannten Herren auf die Theaterästhetik beschreiben kann, ohne dazu die Wikipedia zu konsultieren, dem ist das Theatertreffen selbstredend ein Fest. Die meisten Menschen, für die das gilt, sind jedoch entweder Theaterwissenschaftler, Theaterkritiker oder Theaterschaffende – kurzum: Nerds.
Für viele andere ergibt sich aus einem modernen, unkommentierten Theaterabend jedoch kaum mehr als Kopfschütteln oder Gähnen. Einzig das Publikumsgespräch im Anschluss, welches mitnichten nach jeder Vorstellung stattfindet, kann da nachträglich noch für Erhellung sorgen. Eine in diesem Sinne höflich vorgebrachte Kritik eines eindeutig aus dem bürgerlichen Milieu stammenden Zuschauers nach der Vorstellung von „die unverheiratete“ veranlasste im Übrigen den anwesenden Regisseur zu einigen verbalen Entgleisungen. Unter anderem riet er dem Fragenden statt ins Theater zu gehen doch lieber eine Folge „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ zu sehen…
Muss Kunst weh tun?
Dies führt zu weiteren Fragen. Etwa: Ist einzig die sadistische, die anstrengende, die kräftezehrende Kunst gute Kunst? Mein persönlicher Eindruck ist oft, dass es gerade im Theater meilenweit nach normativem Impetus mieft und nach dem verbiesterten Streben nach intellektueller Distinktion. Und wenn es nicht das ist, dann doch zumindest der Wunsch, in Ruhe Kunst machen zu können, bei völliger Ausblendung des „Störfaktors Publikum“ versteht sich. Doch welchen Sinn hat Kunst, wenn sie nicht in irgendeiner Form bewegen oder berühren kann? Wenn sie nichts weckt, keinen Prozess in Gang setzt? Und wenn die Kunst des Kommentars bedarf, was bedeutet das dann? Dass der Kommentar die Kunst erst zur Kunst macht? Und wenn das zutrifft, warum nur bleiben uns die Theatermacher*innen diesen Kommentar so häufig schuldig?
Klar, es gibt Programmhefte. Aber ganz ehrlich? Auch die sind doch häufig vor allem eines: anstrengend. Wie wäre es stattdessen mit einem digitalen Dramaturgen? Der von der Probe twittert, Vines und Fotos postet, bloggt, Verweise gibt, Materialen hochlädt, verlinkt, Mitwirkende zu Wort kommen lässt, einordnet und kommentiert? Warum nicht den ganzen Prozess einer Theaterarbeit als Teil der Inszenierung begreifen, deren I-Tüpfelchen der Premierenabend ist? Damit würde die Kunst nicht profaner. Im Gegenteil: Sobald sie einbezieht, statt auszuschließen, wird sie umso wirkungsvoller.